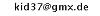Freitag, 27. April 2007
leckt auch einmal die Finger.
(Goethe)

Seit einiger Zeit surrt es durch die Medien: Kollabierende Kolonien - die Bienen sterben aus! Die Gründe sind dunkel, Viruserkrankungen stehen im Verdacht oder Genpflanzen, die ihre eigenen Insektizide produzieren. Angeprangert wird nun auch die lieblose industrielle Haltung der emsigen Tierchen:
Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass der Imker dort mit der Pfeife dasteht und seinen Bienchen zuguckt", zitiert der Spiegel einen Experten für Bienenkunde.
Ja, da haben wir es doch. Ich würde das doch ganz anders halten. Ich habe meinen Bienen bislang immer gerne und gelassen zugeguckt - wie sie alle möglichen Sachen machen in ihrem kessen Ringeldress und dabei zufriedene Summgeräusche von sich geben.
Heute, so lehrt das Internet und der große geheimnisvolle Bienenstock Google, steht es schlecht um die Imme. Vom "Bumsebienchen" muß man lesen oder auch "Biene ist offline". Nur der kesse Dress hat überlebt.
Vielleicht sind am Ende doch die Künstler schuld. Die mit tiefgefrorenen Bienen jonglieren - oder sich drohnenromantisch verlieben, wie nur Dichter es tun: "Ich liebe dich fort, wenn du mich liebst", schreibt Jean Paul. "Bist du die Giftblume, so bin ich die Biene und sterbe in dem süßen Kelch."

Mittwoch, 25. April 2007
Der Mastbaum schwankt im Kreise.
Die Weiber schlagen Purzelbaum,
Das Schiff bewegt sich leise.
(Hugo Ball, "Narrenfest". ca. 1916.)

Das Leben ist ein Varieté, heißt es, und wir nur die Artisten. Einmal traurig, einmal froh, mal bist du oben, mal am Boden - und dazwischen ratlos in der Zirkuskuppel. Damals, seit jenem schrecklichen Unfall - und ich schwöre, das war es! - an der Wurfscheibe, schleiche ich nur von ferne um das bunte Zelt. Natürlich juckt es mir manchmal in den Fingern. An schwüleren Tagen, wenn die Gedanken träge kriechen und ich im verschwitzten Hemde auf meiner Eisenpritsche liege. Einmal noch die Luft atmen, einmal das Geräusch der Manege - einmal noch ein Messerwerfer sein!
Auch übe ich heimlich, nicht fleißig, aber immerhin. Halte die Finger gelenkig, den eleganten Schwung aus dem Unterarm. Ich schaue dabei die alten Fotos an und stelle mir vor, wir beide, du und ich, zusammen in unserer besten Nummer: die Handschuhe, die Augenbinde, die sirrenden Messer. Der Kasper kommt im Zirkuszelt, heißt es. So frivol ist mir nicht zumute. Ich komme mit einem Koffer voller Erinnerungen: meine sehnsüchtigsten Träume, die finstersten Gedanken und zartesten Regungen - alle zur selben Zeit.
Ich bin dann wie Magneto der Gedankenleser, der nach uns im selben Programm auftrat. Der Welt tiefschauendster Telepath, ein Mann mit drittem Auge, dem Vergangenheit, Zukunft und die Nummern der Ausweispapiere gestochen scharf aus dem Nebel aller Erkenntnis sprang. Der kluge Hans, der zwei und zwei zusammenzählt. Nur zu genau will man nicht wissen. Irgendwann lernt man aufzutreten und den Vorhang hinter sich geschlossen halten.
Die alten Zeiten kehren nicht wieder. Heute weht der Wind durch die Zelte, heute liege ich auf meinem Eisenbett und blättere durch die vergilbten Programme, halte zerknitterte Kostüme in den Händen, atme den Duft von Kampfer, Sägespänen und einem leisen Hauch von deinem Parfüm. "It's not, it's not who you kill but it's who you left" singen die Blonde Redhead vom Grammophon. Ein letzter Rest von Wimperntusche. Wir waren wirklich sehr jung damals.

Donnerstag, 19. April 2007
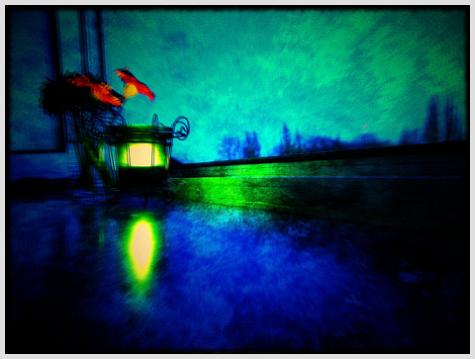
Jetzt wird es gottlob wieder kühler. Ich muß nicht mehr am Fenster stehen, den Weg der roten Sonne verfolgen oder den unruhigen Träumen der Tiere unten im Ufergebüsch lauschen. Jetzt lähmt die Nacht nicht mehr und nicht mal ihre Gedanken. Dafür liegt Gift in der Luft, brennt auf den Lippen, verklebt mir die Nase und macht die Augen schwer. Mit letzter Kraft werde ich eine Nachricht in meinen Schreibtisch kratzen. Hier faßte ich mir ein Herz - und es war nicht meines.
Endlich komme ich dazu, diese Zeitschriftenstapel, die Kisten mit den interessanten Artikeln, den Ausstellungsberichten, dem skurrilen Fund des Tages (zurückdatierend bis 2000irgendwas) mal auszumisten umzuschichten, den großen Stapel in kleinere Stapel zu sortieren, nur um dann alles wieder zu einem großen Stapel zusammenzufassen. Alles soll eins werden und dem Kleinen, dem Alltag, dem Banalen gehört gefällige Beachtung.
In Salzburg gibt es eine alte Villa, die ein begehbares Museum des Krempels ist. Sauber sortiert und beschriftet natürlich. Hundert Jahre Sammelwutlust. Sentimentales Erinnern, das Leben als Archiv, als Zettels Traum. Woher ich das weiß? Ich habe den Artikel aus der Süddeutschen ausgeschnitten und aufgehoben. Boltanski! mag man rufen, aber ich, ich habe alles im Griff.
Denn mit letzter Kraft würde ich natürli

Sonntag, 15. April 2007






Na super. Alle spachteln auf dem Balkon, nur ich, ich muss einsam aufs Wasser starren. Und kein Schiff kommt vorbei. Wenn ich anfange, Gedichte zu schreiben, wißt ihr Bescheid.

Freitag, 13. April 2007
Tambien tu ausencia ha sentido
Porque su luz no ha querido
Mi noche triste alumbrar.
(Pascual Contursi, "Mi Noche Triste". 1917)
Als heute morgen vom Nachbarbalkon leise Tangoklänge herüberwehten, gleich wie der Duft einer recht kleinen Tasse löslichen Kaffees, erinnerte ich mich wieder an die Zeit, damals in Argentinien. Wir lebten, man muß besser sagen, hausten, in einer von Cucarachas bewohnten Bude mit undichtem Dach und wackliger Veranda mitten im schäbigsten Vorort von Buenos Aires. Dort am Río de la Plata war das Leben von ewiger Schwermut und noch schwererer Sehnsucht geprägt. Doch das Elend der kleinen Arbeiter, der überstark geschminkten Straßenhuren, der Trickdiebe und gescheiterten Existenzen, die es aus Europa kommend in unser Viertel angeschwemmt hatte, rührte uns nicht an.

© José Guadalupe Posada
Beim Muchacho!, was waren wir jung! Wir waren verliebt und liebten uns sehr, außer sonntags, da war Kirche. Die Wohnung war klein, der Flur schmal und eng - und eng tanzten wir zu den Klängen des rostigen Aufziehgrammophons, das ich in San Telmo auf dem Marque del Puces erstanden hatte im Tausch für die falschgoldene Uhr meines Großvaters. Fast so sehr wie einander liebten wir die Musik. Abends zogen wir durch die kleinen Pinten in den Barrios, ebenso schlecht beleuchtete wie übel beleumdete Kaschemmen, in denen Touristen ihr Geld und mehr noch ihre Unschuld verloren.
Während ich das Bandoneon spielte, das ich im Unterdeck des Bananenfrachters an den habgierigen Blicken und Fingern der schlechtbezahlten Maate und noch abgebrannteren Auswanderer vorbei über den Ozean geschmuggelt hatte, füllte deine dunkle, volle Stimme die Hinterzimmer der Vinjeras, der von gelben Lampions erhellten Bodegas und Grillstuben. Die Lieder, die wir spielten, handelten vom Tod, von der Liebe und dem Leben der einfachen Leute. War es mein Bandoneonspiel, war es dein Gesang, das die Zuhörer zu Tränen rührte? Vielleicht waren wir beide es, der Duft unserer Liebe, der wie der einer satten Blüte über unseren Köpfen und unseren Herzen schwebte, eine Wolke aus Glück.
Und wie aus Wolken brach auf einmal der Regen los. Es regnete und regnete. Es regnete wohl sieben Jahre lang und danach regnete es einfach weiter. Am Ende war die Feuchtigkeit in die Wände gekrochen, fand sich in den Möbeln, der Kleidung, den Notenblättern. Und irgendwann, nach endlosen Zeiten, so schien es, fand sie sich auch in unserer Liebe. Eine ungesunde, modrige Atmosphäre legte sich um uns, machte deine Stimme fahler und mein Finger klamm. Das Bandoneon setzte Schimmel an, ich traf die Tasten nicht. Die Gelenke schmerzten, und deine Augen suchten immer öfter das flinke Spiel von Marco, der Kunststücke konnte mit seinem Rasiermesser.
Ich sah es wohl, und ahnte viel, ehe ich es wirklich wußte. Es gärte in mir, wenn ich euch die Habanera tanzen sah, in den vielen Pausen, die ich wegen meiner schlimmen Finger immer öfter einlegen mußte. In den Bordellen von La Boca, in denen wir aufspielten, hatte es immer viel Getuschel gegeben. Aber am lautesten traf mich das Tuscheln und Wispern über uns. Über dich und Marco, um genau zu sein. Und genau schaute ich hin. Sah sein schwarzes Haar, das wie dickflüssiger Schiffsdiesel glänzte, sah das gefährliche und lockende Blitzen seines goldenen Schneidezahns und das gefährlichere und darum noch lockendere Blitzen seines Rasiermessers. Er schnitzte damit Figuren aus einer Papierserviette, schnell, elegant und scheinbar ohne viel Aufhebens. Silhouetten von Blumensträußen oder kleine tanzende Pudel, tief dekolletierte, üppige Tänzerinnen und Stadtansichten von Paris, Venedig und Hamburgo. Orte, die er nie gesehen hatte, aber umso blumiger beschreiben konnte. Unecht, wie die papierenen Orchideen, die er mit einer nichtigen Bewegung seines Rasiermessers schnitt und den entzückten Damen ins Haar steckte.
Oh, auch dir. Ich weiß es genau. Auch dir faßte er ins Haar, in den Pausen und unbeobachtet geglaubten Momenten. Immer dann, wenn ich meine klammen Finger an einem feurigen Getränk zu wärmen suchte. Immer dann, wenn du mit einem Teller durch die Reihen gingst, nein schwebtest, um die Almosen der Betrunkenen und der Liebespaare einzusammeln, die unsere Musik gehört hatten. In der vordersten Reihe saß immer Marco, und er ließ mit einem lachenden Blitzen seines goldenen Schneidezahns mit der einen Hand eine Münze auf den Teller fallen, mit einem weithin hörbaren Pling, das lauter war sogar als der Husten, der nach jahrelangem Regen sich bei mir eingestellt hatte, und mit der anderen, bislang verborgenen Hand zauberte er eine frischgeschnittene Orchidee hervor, feingliedriger als die vom oberen Amazonasbecken, dort, wo die bizarreren blühen, die üppigen, selten gesehenen, und steckte sie, immer noch mit diesem blitzendem, goldenen, dreisten Lächeln um den Mund mit einer raschen Bewegung vorne an dein Kleid.

© José Guadalupe Posada
Als die schreckliche Nachricht kam, die entsetzliche, ging ein Klagen und Schluchzen durch das Viertel, hinunter zum Hafen, durch die Tavernen und die rauchigen Salons der Hurenhäuser. Nach einer mondlosen Nacht fand man deinen grausam zugerichteten Körper in einer der vielen dunklen Gassen, einer Caminito im finsteren Teil der Boca. Von Marco keine Spur, nur Blut. Soviel Blut, das manche raunten, es müsse aus zwei Körpern geflossen sein, so sehr hatte es die Ritzen im Pflaster des engen Gässchens getränkt, war zwischen Müll und Unrat geflossen hinein in die gierigen Mäuler räudiger grauer Köter, die im Morgengrauen die Spülsäume der Stadt nach Eßbarem absuchten.
Die Suche nach Marco blieb erfolglos, er blieb wie vom Erdboden verschluckt, ich war nicht überrascht. Die Polizei überreichte mir dein rotes Kleid, zerfetzt und verkrustet von dunklem Blut, ich nahm es, stumm, legte es auf das Bett, unser Bett, und setzte mich auf den abgewetzten alten Schemel, der daneben stand. Die Tränen wollten nicht fließen. Dabei war ich ein Gefangener des schwarzen Schmerzes, ich hörte das Klagen in den Gassen, die Trauer um den Verlust der schönsten Sängerin der Stadt - und doch war mein Herz auf einmal klamm, wie von einem Regen, der seit Jahren in mir fiel. Meine Finger aber waren nach jenem Abend flink geworden. Ich spielte das Bandoneon, huschte über die Tasten, entlockte dem ächzenden Instrument herzzerreissende Töne, unzüchtiges Sehnen und wehmütiges Stöhnen, so daß das ganze Viertel innehielt, still lag und den neuen Liedern lauschte, die so voller Melancholie und Trauer waren. Ich aber wartete auf die Tränen, die nicht kamen, sah auf meine tanzenden Finger und immer wieder hinüber zur Kommode. Dort wo Marcos Messer lag.

Mittwoch, 11. April 2007
In der Nacht zu Karfreitag ist er gestorben. Als man ihn am nächsten Morgen fand, lag er auf den Badezimmerfliesen, mit merkwürdig verwinkelten Armen, so als sei er schon tot gewesen, ehe sein staksiger Körper den Boden berührte.
Er war 94 Jahre alt und hatte bis zuletzt immer noch ausschließlich mit seinem Besteck aus Aluminium gegessen, das man ihm im Gefangenenlager gegeben hatte. Sein Name stand dort eingraviert. Und "U.S. Army".

Montag, 9. April 2007

Im Feuer vergehn, im Krachen der Äste neue Glut, Brandgeruch in der Luft: Nach dem Abendmahl der Zwölf, bleibt nur noch, die Versammlung der Honighasen zu feiern. Wir blenden aus: gewaltbereite Menschen im Nahverkehr, keilende Rammlerbanden in der U3, hysterische Kreischtussen auf schwankenden Kähnen (bitte Hormone und Alkohol immer gut regulieren), kurz: den Mensch in der Masse (schlag nach bei Riesman) als lämmergleiche Blökherde, laut und die Mitkreatur gefährdend.
Ach seien sie doch nur wie das Rhönschaf, das unter den Wollieferanten als widerstandsfähig gilt. Wir wollen es loben. Zu Späßen bereit, aber nicht blöde, bleibt es unanfällig für die Moderhinke und lammt ohne zagen. Kurz, es sei, so der Züchter, "lustig und lecker".

Samstag, 31. März 2007
Grad kam ich drauf, da war doch was. Genau: Die Zeit, als man gleich zwei Beutel Kamillentee in die Tasse warf und derart angeheitert zum Bloglöffel griff. Frei von der angeregten Leber weg sein Ungemach ins Datenleere schrie, die Musik einfach lauter drehte, die Bildschirmdarstellung vergrößerte, um Buchstaben noch lesen zu können - und dann polterdiholter ab.
Die drei, vier Gleichgesinnten oder Staunenden, die dann noch durch die Nacht schlichen, holten sich gleich ein Juxgetränk - und dann wurden weitgehend emissionsfrei letzte Fragen geklärt.
Jetzt, mit frischverlinkten Fremdlesern unterm Stuhl (hallo, liebe Leser der Netzeitung!) geht das alles irgendwie nicht mehr. Möglicherweise, hust, hat man Vorbildfunktion. Manche Gefährten laden einen von Konzerten wieder aus. Andere rufen gleich gar nicht mehr an.
Grad lese ich ja eine Biografie von Horst Janssen. Ich stelle fest, es gibt Menschen, die sind noch schlimmer als ich. Aber auch welche, die sind begabter. Unerträglicher. Betrunkener.
Heute gehen die Menschen früh zu Bett. Was für eine Verschwendung.

Donnerstag, 29. März 2007
Mitleid brauche ich jetzt bald nicht mehr. Denn in naher Zukunft werde ich Millionär sein, dann lache ich mich am Rande meines Pools in einem Penthouse durch den Tag. Ich werde nämlich mit Kondolenzr 2.0 eine tolle neue Sozialplattform ins Leben rufen, die dann von Hubert Holtzmann aufgekauft wird. Für teuer Geld.
Wie das funktioniert? Nun, angenommen - jetzt als willkürlich gewähltes Beispiel - man fühlt sich nicht gut, hat einen Trauerfall in der genetischen Zwangsgemeinschaft oder - ein noch willkürlicher gewähltes Beispiel - einen Unfall. Dann würde man ja gerne eine nette Stimme hören. Nur, woher nehmen in diesen vielbeschäftigten Zeiten?
Kein Problem mit Kondolenzr 2.0. Wer sich anmeldet, erhält sofort einen Klücker ™ (ein Kunstwort aus "Klingeln" und "Drücker" wie in "ich drück' dich"). Wer jetzt angerufen werden möchte für ein Trostgespräch, setzt einfach einen Klücker ein - und wird von einem anderen Nutzer bei Kondolenzr 2.0 angerufen. Wer also viel anruft, erhält viele Klücker, die er in schlechten Zeiten für seinen eigenen Bedarf einsetzen kann.
Supersache, super sozial auch - und ungeheuer kommunikativ. Blogger brauchen das vielleicht nicht, die haben ja Sozialkontakte.
Also, das Motto lautet: Ich klück euch! Oder auch: Heute schon Klück gehabt? Oder: Mit Klück zum Glück! Oder...

Mittwoch, 28. März 2007
verhärmte Hauswirtin soon
(Pulp Fiction)
Den gestrigen Beitrag mußte ich wieder offline setzen - und kann nicht so recht sagen, warum. Jedenfalls wachte ich gegen zwei Uhr auf, mit heiß pochendem Fuß, im fiebrigen Wahn vielleicht, Stimmen hörend wie "Ich bin dein linker Fuß! Gib' mir einen Stift, auf daß ich was malen kann!"
Bald dachte ich, halb paranoid, es sei nicht gut, das Leiden meines Fußes der Nach- und demi-monde anzuvertrauen. Aber der Zeuge meines gestrigen Unfalls versicherte mich, meine verkehrserzieherischen Belehrungsversuche dem Unfallgegner gegenüber seien zweifelsfrei einem physischen und psychischen Stolpern zuzuordnen gewesen, ausgelöst durch den Zusammenprall von Mensch und Maschine.
Jedenfalls bewahrte ich heute meinen lädierten Fuß während eines langen Arbeitstages in einem Kübel Eiswasser auf, dachte erst an die vielen guten Wünsche, später an meine Zeit als Eisenfuß auf dem linken Flügel in der C-Jugend von Sportfreunde Wichlinghausen, zuletzt dann an die literaturwissenschaftlichen Implikationen meines Zustands. Denn wie jeder Kenner der amerikanischen Literatur weiß, ist dort jeglicher Hinweis auf die Fußverletzung des männlichen Helden als Impotenz zu deuten. Das liegt am starken freudianischen Einfluß der Autoren dort und ist nachzulesen bei Melville, Hemingway oder John Irving. Also, schreibt auf: Jedesmal, wenn sich der Held in einem amerikanischen Roman einen Splitter in die Ferse jagt, geht bei ihm gar nix mehr.
Dem Bildungsauftrag genüge getan, kehre ich zurück zum Spiel. Eine Hauswirtin nahm mich heute vertraulich beiseite (ich wies schnell auf den maladen Fuß, um Näheres zu verhindern) und klagte über die spielenden Kinder im Innenhof. Zweimal schon hätte sie eine Scheibe ersetzen müssen, weil ein Ball ins Fenster geflogen kam. Immerhin habe man jetzt die Grundstücksgrenze zwischen den Häusern markiert: Bis zum Sandkasten liefe sie, das wäre nun deutlich zu sehen. Ich sprach etwas vom "Leben und leben lassen" und war doch erstaunt. Bislang war diese Art Kinderfeindlichkeit, die in der Hansestadt schon weit traurigere Schlagzeilen gemacht hat, mir mehr ein abstraktes Problem aus der Tageszeitung gewesen. Hier aber stand es in abgehärmter, postmenopausaler Zierblondsträhnigkeit. "So ein Ball gehört halt in 'ne Scheibe", dachte ich, aber eher leise und für mich, denn am frühen Morgen und mit Hinkefuß will man ja nicht alles diskutieren. "Auf der Hauptstraße können die ja schließlich nicht spielen", rutschte mir noch raus.
Nachher fährt denen noch einer über den Fuß - und schon geht es los mit dem Aussterben. Darüber könnte man dann höchstens noch Romane schreiben.
>>> Fußverkehr in Deutschland