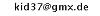Freitag, 6. April 2012

Der letzte Radausflug hängt mir nach, nach wie vor bin ich beschämt über diesen Leistungseinbruch, das schwankende Mühen. Immer noch fühlt sich mein Körper an, als sei ein Laster über ihn hinweggefahren, es hat so etwas Zermalmtes, Zerflossenes, in alle Fasern strömendes. Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren mal den Kontakt zu einem Auto suchte und aus der Bahn geworfen wurde. Erst durch Metall, dann durch Überraschungen aus dem Leben und Zusammenleben, es sind ja immer Ketten des Unglücks, die Glied um Glied ineinandergreifen. Es gibt in diesen (und allen anderen) Momenten nur die eine Order: Schnell wieder selbst ans Ruder, rauf auf die Brücke, Mütze auf, Schleppleinen kappen, Herr im eigenen Leben werden, nicht aufs Telefon warten.
Mein nächstes Rad sollte eigentlich ein hübscher Flitzer werden, etwas Leichteres als mein fliegender Holländer, auf dass sich der Radius erweitere. Nun konnte ich aber nicht widerstehen, als ich die Cyclette entdeckte. Liebe zeigt sich oft auf überraschende Weise und hat so viele Gesichter. Für eine symbolische Ablöse und der Hilfe von Freunden fand der neue Flitzer den Weg in meinen Leuchtturm, steht bereit für Ausritte in ein völlig neues Leben bei Nebel, Sturm und Regen. Das Goldrad aus französischer Fertigung, aber Kölner Vertrieb, ist einem guten Zustand. Gerade mal 3123 KM gelaufen, Erstbesitz und scheckheftgepflegt, ist offenbar nur der Originalsattel einmal ausgetauscht worden. Die Filzbremse, mit der man Berg- und Talfahrt simuliert, funktioniert, der Tacho und Kilometerzähler auch. Das habe ich heute morgen, als ich mal einen Kilometer nackt zum Bäcker fuhr, ausprobiert. Ich wäre bereit, nur mit einem T-Shirt bekleidet, in einen luftigen Sommer zu fahren, der Sonne und der Weite entgegen, Picknick am Wegesrand. Der Tacho geht bis 100, für den Fall, daß es einmal steil bergab geht oder ich eine Kraft in den Beinen entwickle, die Clark Kent erblassen ließe.
Eines freilich fehlt. Der Soziussitz für die Motorbiene. Da hilft nur ein zweiter Flitzer, den man danebenstellt. Dann aber: gemeinsam in den Sonnenuntergang, durch grüne Täler und saftige Auen, entlang dem großen, langen, gewundenen Fluß.

Sonntag, 25. März 2012

Ein gezwungener Versuch, die Müdigkeit aus den Knochen zu schütteln, Schotterstraßen abrumpeln, Rundwege, die unrund laufen. Knapp 20 lächerliche Kilometer, die aber nicht ohne Pause gehen, ein finsteres Ergebnis, von dem ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Kraftlosigkeit.
Immerhin Sonne, Vitamin D bilden, wie man so sagt, und das Gleichgewicht gehalten. Im Saarland wird bunt gewählt, das wird entweder langweilig oder sehr lustig. Die Fotos von Ed Ross, die er mit Plattenkameras macht, bringen mich auf die Idee, endlich mal meine letzten Filmvorräte aufzubrauchen. Schon allein, um das Tiefkühlfach freizuräumen. Ich versuche, mir gerade Ziele in alle Richtungen zu setzen, Sichtweise zu fordern.
Nachmittags dann Ruhen im Lesestuhl, ich höre das neue Album von Lee Ranaldo, das mir mittlerweise besser gefällt. Textlich manchmal etwas wenig einfallsreich, mochte ich anfangs auch die auffällig zurückhaltenden Arrangements nicht. Merkwürdig gezähmt schienen mir Sound und Willen ("Die Welt als Wille und Gassenhauer"), vom George Harrison von Sonic Youth hatte ich mir weniger domestiziertes erwartet. Aber da hatte ich das Album noch unter Kopfhörern gehört, als der der Klang noch in zuviele Einzelteile zerfiel. Lauter spürt man den Druck, hüllen einen auch die zugänglicheren Melodien ein, wie überhaupt eine gewisse Entspanntheit über dem Werk liegt, vor allem, wenn man es mit der Nöligkeit der Thurston-Moore-Soloalben vergleicht.
Ein bißchen Blättern in Magazinen, die schwache Hand bewegen, Inventur machen in Haus, Hof und Herzen. Abwarten. Erstmal weiter abwarten.

Freitag, 18. November 2011
Neuerdings drücke ich morgens im Bus nicht mehr auf "Halt", in der flaumfedrigen Hoffnung, er möge einfach an meiner Station vorbeifahren, einfach immer weiter und dann noch ein Stück, weiter als ich jemals gefahren bin, bis zu einem unbekannten Land einer unbekannten anderen Haltestelle. Dann steige ich aus.

Dienstag, 18. Oktober 2011

Stück für Stück und noch ein Stück ausprobieren, was geht. Das Schwimmflossengefühl ist weg, dafür könnte man jetzt mal über Ameisen reden, aber die gute Nachricht ist: Das Gehen wackelt nicht mehr so, vielleicht wird "fester Schritt" wieder ein abrufbares Programm. Völlig frustrierend indes die Degeneration nach zwei Wochen Krankenhaus. Die Stufen zum Leuchtturm haben sich in meiner Abwesenheit offenbar verdoppelt, ich wünsche mir ein Bank zum Verschnaufen auf Etage zwei. An den letzten Sonnentagen vor dem großen Regen nun der nächste Test: Gleichgewichtsübungen mit dem Fahrad. Siehe da, es geht. Vorsichtshalber habe ich mich aber erstmals zum Tragen eines Helms überredet, better safe than sorry hieß nicht umsonst das Motto meiner Ahnen.
Als ich vor sieben, acht Jahren in meinen kleinen Stadtteil zog, war die kleine Elbinsel in der Nähe ja nur wenigen Skatern, Radlern, Hundeausführern bekannt. Ob beim heimelig verregneten Nachtspaziergang oder sonnigen Wochenendausflug, es war der ruhegetränkte Gegenentwurf zum westlicheren Elbwanderweg. Damit könnte es bald vorbei sein. Aus der lange leerstehenden Betriebsvilla der ehemaligen Wasserfilteranlage, dort also, wo ich einst mit einer Bloggerin ein Heim für durchreisende Internetaktive betreiben wollte, hat man nun ein Restaurant gemacht. Glücklicherweise aber nicht den vor Jahren mal angedachten "Eventpark" mit Wasserspielen, gigantomanischen Türmen (Hamburg würde gern Bilbao sein) und Autoreiseverkehr. Bis zum Parkplatz neben der wahrscheinlich kleinsten Menükarte Hamburgs ist die einst gesperrte Straße zwar nun offen. Aber noch hält sich der Verkehr in Grenzen. Das könnte sich im nächsten Frühjahr ändern, wenn in den Zeitungen wieder die Ausflugsziele, die keiner kennt, beworben werden. Versteckte Perlen, verwunschene Idylle werden dann wie Dornröschen mit ungemachten Haaren aus dem Schlafzimmer gezerrt, und unversehens nur im Hemde noch vor gaffendes Volk gestellt. Denn rund ums Café hat man einen überraschend hübschen "Naturlehrpfad" gebaut. So kann man auf weltkriegsbombengeräumten Wegen an den alten Filterbecken vorbeiwandern, Vögel beobachten und Pflanzen beim Wachsen zuschauen, in die alten Pumpenhäuschen schauen, die wie kleine Schmuckstücke auf dem Gelände versteckt sind und von einer Gründerzeit erzählen, als selbst technische Zweckbauten noch wie schmucke Repräsentationsgebäude errichtet wurden.
Zwanzig Kilometer mit vielen Pausen. Immerhin, es geht.

Montag, 5. September 2011

Ich liebe ja Hochzeiten. Beerdigungen haben auch ihren Reiz, vor allem, wenn es einen selbst nicht betrifft, aber Hochzeiten haben oft das bessere Essen, die bessere Musik und obendrein meist die bessere Laune. Wenn es also irgendwo eine Hochzeit gibt, ich bin dabei. Beinahe ist es so, als hätte ich allzeit bereit eine kleine Reisetasche wie einen Notfalleinsatzkoffer für Hochzeiten neben der Türe stehen, in der ein freundliches Hemd und eine festliche Jacke darauf warten, mich zu einer Trauung zu begleiten. In meiner kargen Freizeit lungere ich manchmal vor dem Standesamt herum, klatsche Beifall für die Brauleute, hake mich unter, biete mich als Trauzeuge an. Ein wenig trage ich mich sogar mit dem Gedanken, mich allein deshalb doch bei diesem Facebook anzumelden, um Mitteilungen über bevorstehende Hochzeitsfeiern zu erhalten, um dann wie eine Art Owen Wilson in Die Hochzeits-Crasher hereinzuplatzen, ein wenig fröhliche Melancholie wie Blütenblätter oder Reiskörner zu verstreuen, und generell der Erste zu sein, wenn der Hochzeitskuchen endlich zerteilt und die Schnitten herumgereicht werden.
Es herrschte ja früher so ein Hunger. Einer dieser großen, einer nach diesem allem, vor allem in der ersten Zeit in dieser großen Stadt. Am Wochenende also fanden glücklicherweise meine zuvor unablässig gemurmelten Gebete Gehör für ein kurzes Zwischenhoch, und ich ließ mich kurzerhand ins Schleswig-Holsteinische Guts- und Begütertwesen entführen. Hochzeit auf dem Lande, das ist sozusagen das Crèmeschnittchen unter den Hochzeitsfeiern. Zwischen Scheunen, Herrenhäusern, Pferdeställen, weißen Pavillons auf grünem Cricketrasen fühlte ich mich zunächst wie beim Jahrestreffen von Young, Young, Young & Söhne, denn um mich herum lungerten zunächst halbjunge, den konservativen Parteien nahestehenden Menschen in Gel und Nadelstreifen (die Schuhe, ihr Aktenkoffermänner, immer habt ihr so dürftiges Schuhwerk an!) begleitet von ihren Begleitfrauen, den zukünftigen First Ladies und Beilagen.
Diesmal allerdings war ich das Ziermöhrchen, kannte quasi keinen, konnte also wahlweise behaupten, entweder zur Seite der Braut oder der des Bräutigams zu gehören. Auch diese kannte ich nicht, war aber spaßeshalber der erste bei der Gratulation, knuffte den Gatten und flüsterte der Braut, nachdem ich mich zutraulich in ihr Dekolletée gedrückt hatte, zu, ich hätte gehört, es gebe sehr guten Kuchen.
Den gab es auch, und dazu dieses ausnehmend schöne Wetter, das sich wie ein Urlaubskatalog um die schönen Menschen legte. Während ich, ein einfacher Mann aus dem Mittleren Westen, den es auf die Hamptons verschlagen hat, vom Liegestuhl aus die Szenerie beobachtete und zu dem Schluß kam, daß diese Feier wie ein Urlaubsort war, nur mit besser gekleideten Menschen und keinen, die in bunten Bermudas und Badelatschen die Szenerie verschandeln, umwuselten mich kecke Kinder auf Laufrädern, teilnehmende Verwandte, keine Hunde, aber Raucher und andere freundlich herausgeputzte Gäste. Im, nennen wir es Herrenhaus schnupperte ich an den Lüstern, suchte die Bibliothek vom großen Gatsby, fand an meinen Fingern keinen Staub, als ich den Lack der Möbel prüfte.
Draußen auf dem Rasen klöppelte inzwischen der Grillimpressario auf seinem Flammenrost beidhändig mit den Zangen herum, daß er aussah wie ein Vibraphonist oder Marimbaspieler, der eifrig die Musik begleitet, die von der lampionverhängten Tanzfläche herüberwehte. Bessere als ich zunächst befürchtete, wie ich festhalten möchte. Ein blondes Mädchen im luftigen Kleid erinnerte mich an eine Exfreundin, und kurz überlegte ich, ob ich nicht mit ihr durchbrennen sollte, war sie doch mit einem Mann zusammen, den sie nicht brauchen konnte. Dann fiel mir ein, daß besagte Exfreundin mich einst auch nicht brauchen konnte, wandte mich also lieber erneut diesem fantastischen Kuchen zu, unterhielt mich mit einem Paar aus Berlin, die aufatmend gesund aussahen und muntere Dinge über Stadtentwicklung zu berichten wußten. Zwischen dem Bräutigam und mir paßte irgendwann kein Blatt Papier mehr, wie man so sagt, wir haben uns quasi für den Abend "geaddet", und er hatte sich sogar meinen Namen gemerkt, wie ich merkte, als er mir im vertraulichen Ton zuflüsterte, daß im Kühlhaus noch Massen an Kuchen standen. Gute Menschen, allesamt.

Montag, 29. August 2011


Die Mansardenwohnung erlebt eine Spinneninvasion, die achtbeinigen Seilkletterer haben die Nasen voll vom in sich selbst verknoteten Wetter und drängen hinein in die Küche, die gute Stube, das Ankleidezimmer und die fahl nur beleuchteten Winkel der Diele. Bleich aber sitze ich nicht unter wildem Wein, sondern zwischen Nacht und Regenwolken. Nach einer Woche, in der ich mir vorkam wie ein rollschuhlaufendes Telefonvermittlungs-Girl, die vor einer großen Schalttafel auf- und abfährt und mit bunten Strippen neue Verbindungen knüpft, gehetzt vom aufgeregten Klingeln und Blinken drängender, in Bakelit gefaßter Signallampen, erschöpft die Zeit gestohlen, zwischen auf- und abschwellenden Regenschauern eine Runde mit dem Rad zu drehen. Laß uns über Regenkleidung sprechen. Laß uns sehen, wie die Arbeiten am alten Wasserfilterwerk vorangehen. Wege sind schon um die Becken gelegt, an den hübschen Pumpenhäuschen vorbei, die alte Villa steht offen, aber zu viele Spaziergänger behindern eine heimliche Inaugenscheinnahme.
In den letzten Wochen noch einmal Carnivale gesehen, um endlich die zweite Staffel anzuschließen, langsam, langsam arbeite ich den Berg hinunter, die aufgestapelten Bücher, die zu Staub zerfallenen Gedanken, Textanfänge, Bildideen, die nun von den eingewanderten Spinnen eingewoben und verschnürt werden, bereitgestellt wie Paketsendungen aus einem früheren Leben. Sonntag mit der Lu auf Schiffspassage. Elbfährenflaneure, die Welt als Schaufenster, an dem immer neuer Regen langsam herunterperlt.

Montag, 15. August 2011

Im Vertrauen auf die Wettervorhersage lieber am Samstag Rad und Körper bewegt, endlich wieder Licht am Himmel und trockene Luft. Ab also über die Elbbrücke, die Räder schnurren dem Blech entgegen, auf der Autobahn drängt sich Rückreise-, Fußball- und Einkaufsbummelverkehr in die Stadt. Durch die Peute, die in den letzten Monaten auch die restlichen Kopfsteinpflasterstrecken verloren hat, weiter zu den Elbdeichen. Georgswerder, Moorwerder, irgendwo ist ein einsames Schützenfest. Dorfmädchen mit Cowboyhüten warten an der Bushaltestelle mitten im Nichts, ein älterer Mann mit Jeansweste ißt eine Bratwurst, Schlagermusik ist gleich schon verweht wie der Hase, der tot auf dem Radweg ruht.
Hinunter zur Bunthäuser Spitze. Möglicherweise ist es der Welt kleinster Leuchtturm: Das Leuchtfeuer Bunthaus wurde 1913 errichtet, strahlt heute aber nur den Charme der Zeit und keine Signallichter mehr aus. Hier teilt sich die Elbe, die Sonne glitzert über dem Wasser, das Sportboote zerpflügen, gegen den Strom und mit dem Strom und quer zu den Wellen.


Einen großen Bogen weiter nach Wilhelmsburg, das Dockville-Festival zieht wie ein Magnet Fahrradfahrer an. Junge Menschen mit Frisur und in richtiger Kleidung, wo man sonst nur pfeilschnelle Neonblitze in hautengen Lycraanzügen auf Rennrädern sieht. Die Mode du jour sind Gummistiefel zu Hotpants und flatternden Kleidchen, die Jungs in engen Hosen, deren Schritt auf Kniehöhe hängt, sie sind noch nicht im sogenannten praktischen oder Funktionsalter. Selbst die Gummistiefel der Jungs sind mit Blümchen und Girlanden verziert, nur wenige haben sich Plastiktüten um die Chucks gewickelt. Es muß matschig sein auf dem Gelände, ich lungere draußen herum, höre ein wenig Musik, schnuppere Atmo, versuche einen Witz. "Ach, ich wollte doch nur meine Tochter abholen", murmel ich gespielt verzweifelt und halblaut vor mich hin, ein paar Mädchen stoßen sich an, kichern und wiederholen flüsternd meine Worte. Ich hab's noch drauf, denke ich. Anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dann aber setzt das Nachdenken ein und die bittere Erkenntnis, daß die Görls das längst nicht so ironisch verstanden, wie ich es meinte. Man muß es sehen wie es ist: da steht ein nicht mehr ganz junger mittelalter Mann mit grauen Haaren im Matsch und jammert festivalverloren nach seinen Bezugspersonen. Schlimm, wenn einem die kokettierende Verstellung nicht mehr abgenommen wird. Besser, ich versuche die Nummer noch mal in Ruhe vor dem Musicalzelt.



Zurück dann durch den Hafen, die Beine etwas über die Kaimauer baumeln lassen. Auf der einen Seite geht die Sonne unter, auf der anderen ragt bereits der Vollmond über den Horizont. Ein weiter Blick, von gestern bis morgen dann. Abendmilde Luft, 45 Kilometer rum, Bilder und Licht und Luft. Zeit, dem Abend entgegenzufallen.

Dienstag, 19. Juli 2011

Man könnte viel Jammer äußern, über Wetter, Wehen, Wagnisse. Krise und Krankheit und Ausgelaugtsein. Aber verglichen mit dem, was andere derzeit niederdrückt, muß ich mich am Kragen packen, kurz durchschütteln und feststellen: Es ist nur Arbeit. Kein Verständnis also für Gezänk, launisches Befindeln von links oder rechts, dem Geschnaufe der Hobbyempörten. Raus heißt es, durch ebenso launischen Regen, rauf aufs Rad, Luft holen, ein weiteres kleines Häuschen besichtigen, schüttere Stellen im äußeren Haarkranz der Stadt, ausgefranste Fabrikgebäude und landestypisch Aufgestapeltes. Eine Stulle im idyllischen Nichts, Blick auf strukturloses Grün, Kilometer zwischen Deich und Windkante, ein Entmagnetisieren aus dem Dissonanzraum.

Samstag, 18. Juni 2011
Viel zu lange bin ich nicht dort gewesen, das merkte ich gleich, wie ein enggezinkter Nissenkamm mußte ich mich folglich durch die engeren Straßen und Gassen der inneren Bezirke arbeiten, wie durch das Fugenwerk mit Liebe verlegter Fliesen, nachschauen, ob alles noch da, am Platz, verankert ist. Es ist alles noch da, vieles noch, das meiste sogar, verankert, gesetzt.

Man hätte eine Rundfahrt machen können, auf schickem Gefährt und in noch schickerem Aufzug, wie einer dieser Mad Men durch die Stadt rollern, bis man innehält, das Tempo rausnimmt und diesen entscheidenden Gang zurückschaltet. Mein Programm war folglich angemessen entspannt: laufen, die Schritte vermessen, die Höhen schätzen und die Dicke der Mauern. Die Sonne auftanken, von deren Kraft zurück in Hamburg gleich nichts mehr zu spüren ist.

Auftauchen also, im Museum bei den toten Tieren sitzen, gemütlich nach Luft schnappen, ein melancholisches Lied in den Abend zittern. Sich einfügen.

Dienstag, 7. Juni 2011

Diesmal war ich zwar pünktlich am Flughafen, bummelte aber irgendwie nach dem Sicherheitscheck noch so herum, wollte dann gemütlich und vorentspannt zum Gate, also irgendwie lässig sein, und stellte dann fest, hui, vergessen, das ist ja doch noch ein ganzes Ende... Ende. Daß mein Name bereits ausgerufen wurde, merkte ich erst beim zweiten Mal, wurde der doch so merkwürdig intoniert, so als sei ich ein schottischer Fußballprofi, der sich bei Rapid bewerben will. Der Mann am Boardingschalter telefonierte schon leicht angeregt mit der Crew ("Ah, er kommt gerade!"), als ich ebenso leicht schnaufend um die Ecke bog, und so schlitterte ich auf blanken Absätzen an Bord, also nicht wirklich gemütlich, wie es der Plan war, aber alles gut, möchte ich gemütvoll betonen, wir hoben pünktlich ab.
Wien zeigte sich gleich ganz liebenswürdig, eine satte Sonne am Himmel, man holte mich sogar vom Flughafen ab, und weil ich noch auf meinen Vermieter warten mußte, sagte ich, "Also jetzt aber Kaffeehauskultur!" und wenn schon, dann richtig und mit draußen sitzen. Oder eben konterkarierend. Die Wohnung dann wie ein "Hotel New Hampshire", unten die Damen, im Keller die Anarchisten, ganz oben die Dichter mit Flucht auf den Trockenspeicher. Kochen und Tratsch im Stiegenhaus. Dafür Kronleuchter, Parkett und Messingbett, eine Anmutung von Tradition, ansonsten aber sehr lebendig. Sag ich mal.

Hinaus dann zu ersten Runde, mal wieder Hallo sagen dem großen Kontrast, zehn Jahre Museumsquartier, ein Lied auf den Lippen, auch wenn die Tram die falsche Nummer hat. Vielleicht, so eine erste herausgeschrammelte Botschaft, muß man im Leben auch mal weiterzählen. Und weiter erzählen.