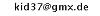Freitag, 5. Oktober 2018
I took bulb form
My body electric will writhe in vain
(Cocteau Twins, "When Mama Was Moth")

Manchmal, wenn ich abends in meinem Geheimlabor sitze und obskure Experimente an armen Seelen durchführe, hoffe ich, Antworten finden zu können. Warum Leute immer so weltumgreifend tolerant sein können, solange sie es nicht selbst betrifft. Warum Menschen nur das Beste wollen, solange sie es nur selbst betrifft. Warum Menschen manchmal nicht hinhören, finden, daß immer nur die anderen zu viel reden, warum immer nur eigene Probleme zählen, man für die anderen nicht verantwortlich ist.
Man kann den Untersuchungsobjekten allerdings mit den gewagtesten Instrumenten zu Leibe rücken, peinliche Befragungen durchführen, die Stimme erheben. Wie tot, schweigen sie still. Sie schweigen still, wie tot. Wenn einer sagt, "Mach mal Herbst!" welke ich ein, wie ein abgefallenes Blatt, stelle mich starr, so daß man meine Knochen knacken hört, will einer mich bewegen.
Mutter schickt ein Paket mit Schokolade. Tiere kauern wie leblos in den Wäldern. Pilze zittern, in den Körben der Jäger liegt kein Kuchen und kein Wein. So sieht es aus, und alles aus den Fugen.
>>> Geräusch des Tages: Cocteau Twins, When Mama Was Moth

Freitag, 11. August 2017
No wonder you are always lost
As a messenger you must be known
With messages you must return
(Blonde Redhead, "The Messenger")

"Get fit or I'll kneecap you!" Na, toll. Jetzt werde ich auch noch bedroht. So bin ich nun schon aus Selbstschutz gezwungen, fluchend Liegestütze zu machen, während im Fernsehen Leichtathletik läuft, noch mehr Gemüse in mein Essen zu schnibbeln und trübe Gedanken wegzumeditieren. Nutzt ja nichts. Unangestrengt achtsam heißt das statt Schulterzucken, Aggression oder Rauswinden, wo gibt es denn so was noch.
Verbindungen knüpfen, ein delikates Geschäft. Strippen ziehen, den Staub aus den Jacken klopfen. Schweißtreibend altes Laub und Geäst wegräumen, den Acker umpflügen wie so ein Gartenbesitzer. "No sour meadows", richtig ausgependelt, den Stand des Mondes beachtet. Über Kreise reden, Zirkel, die sich schließen und weiterschrauben. Das Unwahrscheinliche in einer schnell gezimmerten Echokammer ausfüttern mit dem Auflisten von Zufällen. Daß ich genau dieses Buch habe. Daß sich Sequenzen bilden und Oktaven. Daß ich bis drei zählen kann. Daß man gleichzeitig Zeitzonen nachschlägt.
Pattern recognition als weithin phasengerechte Beschäftigung. Das Summen der Leitungen hören, irgendeinen Windhauch. Störungen. Gespür haben. Manchmal auch kein Gespür haben. Oder Worte haben. Oder wieder ganz viele haben. Das ist schon sehr unwirklich, und man denkt an die Zeit, als man Brieftauben schicken mußte und hoffen, daß kein Fuchs die fängt, oder die sich nicht verirrt. Mein Vater rät zu einem Reisepaß.
Immerhin. Andere gehen Tauben füttern im Park. Andere gehen Tauben vergiften im Park. Andere stellen sich taub.
>>> Geräusch des Tages: Blonde Redhead, The Messenger

Sonntag, 23. Juli 2017
To light that fire
It will take you to the
Darkest part of the weather
(Warpaint, "Undertow")

Gemütlich mit der Nase an die Scheibe gepresst ist so ein großes sommerliches hurly-burly, Rumpelpumpel wie der Dorf-Shakespeare hier sagt, eine faszinierende Sache. Angeschwitzt von der schwülen Hitze fließt die Elektrizität gleich viel intensiver durch den Körper, ja, auch dahin. Sofort fallen einem ein bis drei Menschen ein, mit denen man dann faserlos nackt gekleidet im großen Suppentopf rühren wollte, fire burn, and cauldron bubble. Manchmal schlägt es ja auch wirklich wie ein Blitz ein, ein Gedanke zum Beispiel.
/Ich schaue mir das so an. Regen, Blitz, auch dunkle Wolken. Aber he, schleudere ich dem Dorf-Shakespeare den Dorf-Hemingway entgegen. The Sun Also Rises. Man muß angeblich nur durch die Wellen tauchen, die nackten Füße tapfer in den Regen setzen, ruhig auch den exakten Einsatz verpassen. Mal kurz auf Risiko. Mal kurz die Strömung ziehen lassen. Mal gucken, ob die anderswo tatsächlich gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Mit dem Finger so Linien nachzeichnen wie bei ganz nebenbei angefertigten Telefonkritzeleien. Blitzen über dem dunklen Himmel hinterherzacken, Zigzagging durch fremde Straßen. Was - längst untergezogen - alles so geht. Geduld. Geduld.
>>> Geräusch des Tages: Warpaint, Undertow

Mittwoch, 12. Juli 2017

Wie unter Äther. Der Vollmond zieht die Backen ein, den aufgedunsenen Bauch, Zeit wird es, daß Ruhe einkehrt. Der Wind weht Wolken hin und her, Zeit, die Finger ausgestreckt zu halten. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Greifhände, Protesthände, Gitarrenhände. Schön ausstrecken, nicht Zittern, einzeln vor das Licht halten. Dann Schatten malen. Die Wolken an der Decke verfolgen, Jetstream über Wendekreise, mit den Fingern anstupsen, umlenken, wie unruhige Tiere, die ein Ziel suchen. Einatmen, Ausatmen, Fresse halten.
>>> Geräusch des Tages: P. J. Harvey, When Under Ether

Montag, 13. Oktober 2014
Am Ende dann doch noch im Herbst angekommen. Die Landung mag immer weich sein. Der Rest folgt bekanntlich drei Tage später.
Neulich einen schlimmen Traum gehabt. Angekettet wie ein Galeerensträfling, war ich dazu verdammt, bis in endlose Zeiten auf einem Bier-Bike die Reeperbahn rauf- und runterzufahren, während drei Nornen als Fahrgäste mit an Bord waren, die auf leiernden Harfen mein dunkles Schicksal klagten. Ich sollte meiner Liebe zu Ludivine Sagnier entsagen, fordertern sie, weil diese ohne Zukunft sei. Ein Leben in Untertiteln drohe mir, eine sprachlose Liebe in Fragmenten. Die schwitzigen Laken fanden sich morgens leer neben mir, von einem vollen Mond getränkt.
(Café de Flore. Kan./F. 2012. Regie: Jean-Marc Vallée. Musik: Sophie Hunger, "Le Vent Nous Portera".)

Donnerstag, 21. November 2013
Wir müssen die Welt vom Benzingeruch befreien. Erkläre ich Menschen, die nur noch für ihren Nachruf schreiben.
Wir sangen Texte, die wir nicht verstanden. Und hielten uns Tiermasken vors Gesicht. Eine Leberwurst.
Im Schwedischen gibt es das Wort Pysseltips. Das hat etwas mit Handarbeiten zu tun, woran man sieht, wie schön doch diese Sprache ist. Pusseln statt Gewehre durchladen, antworte ich.
Im Wintergarten sitzen, im Buch der Sieben und Dreißig Wollüste blättern. Ein Geheimnis ahnen.
Den Gedanken säuberlich die Haare kämmen, das Knacksen des Plattenspielers versteckt hinter der wuchernden Zimmerpflanze. Gut seht ihr aus, summe ich. Ganz proper.
Wie zwei Kinder, die vor einem Gebüsch kauern, sich einander an den Händen haltend. Einem Tier beim Sterben zuschauen.

Dienstag, 23. Oktober 2012
In meiner Zeit als Trash-Art-Filmer reüssierte ich mit Werken wie Die Melancholie der zarten Kannibalin, in stelzenhafter Eleganz ausdeklamierte philosophische Selbstbespiegelungen (entlarvender dann nur noch in meinem zweiten Film Bauchnabel der Bohème) mit grobkörnigem Sex und falschfarbenen Splatterszenen. Das kam im Uni-Filmclub vor anderen verklemmten Studenten und auf sogenannten Schalbierpartys zwischen welken Erdnußflips und abgestandenem Haarspray gut an. Wir haben sowieso viel gelacht.
Es war so die Zeit. Große Kunst, großes Leid, dann noch mehr Stuß und ein Spritzer Verachtung. Trümmerliteratur der Post-Boom-Jahre, zusammengedacht in schlecht gelüfteten Räumen, unbeheizten Kellerateliers, die möbliert waren mit alten Fischkonservendosen, die nun als Aschenbecher dienten. Manchmal waren auch Mädchen da, damals, als man noch nach Blättchen fragte. Aber nicht so oft, wie heute getan wird von Pete oder Mike oder Tom oder wie die damals so hießen.
So alle. Anders als heute war das Leben noch nicht ständig rot unterkringelt, das war alles noch sehr richtig dekliniert und wenn nicht, dann fiel das keinem auf. Die Kannibalin zum Beispiel. Ich sagte "Geh mal von links nach rechts" oder "Schau mal melancholisch aus dem Fenster", während ihr wegen der Scheinwerfer überdick aufgetragenes Make-up eben auch wegen der Scheinwerfer zu einem schwarzen Schlotz zerlief. eine zarte Kannibalin unter 2 mal 1000-Watt-Halogen. Das war dann schon auch Arbeit. Das war nicht nur einfach so. Gar nicht einfach so.

Samstag, 12. Mai 2012
Krisenzeiten, Umbruchzeiten, diese Zeiten, um zu schauen, wo man selber steht, wo andere stehen, wie andere zu einem stehen, wie es überhaupt so steht. Welche Wege man geht, wie schnell man sie geht. Ob man sie langsam geht. Oder überhaupt nicht mehr geht. Oder überhaupt nicht mehr kann.
Weil man nicht will. Weil man nicht kann. Weil man denkt, du kannst mich mal.
Nachschauen, welche Schublade man umdreht, welchen Schrank man umräumt, welchen Karton man wegwirft, die Sicherungen rausdreht, den Raum nicht mehr betritt, das Zimmer.
Die Gespinste entfernt, dem Bla und dem BlaBla nicht mehr zuhört, das Halbgare nicht mehr ißt, sich mit Unverbindlichem nicht mehr die Hände verbindet. Oder die Arme, die Haut, den brennenden Nacken.
Den Kontostand prüft, letzte Überweisungen rausschickt, die Defizite wegstreicht, einfach abstreichen den Scheiß, die offenen Rechnungen und Posten, auf deren Eingang man warten oder auch warten kann oder es lassen, weil ja doch nichts kommt.

Freitag, 15. April 2011

Runter die Straße, Achtung Kopfsteinpflaster. Mein Himmel gekränkt, so ein Geruch von ungefähr an den Fingern, man will es nicht wissen. Ich zähle auf: Stich für Stich und Schnitt für Schnitt und Beule für Beule. Ein Auto weht Musik herüber, ein Pumpen und Drängen aus der frischgewaschenen Hamburger Nacht, der Atem versteift, es hat lang schon nicht mehr geregnet kurz bevor der Morgen kam.
Damals also, ich fuhr mit fremden Autos durch die Nacht, zog an fremden Zigaretten, krauchte in fremde Pullover, lutschte an fremdem Kaugummi. Wir stahlen uns Bedeutung, schlürften fahle Morgensonne, verbrannten Beton und falsche Utopien, küßten uns im Schatten der Industrieanlage, drehten unsere Schuhspitzen in Pfützen von Benzin, dachten an ein später, das gestern bereits war.
Damals, mit dir, wollte ich alles stehlen. Das Oben, das Unten, den Glanz und den Zuckerguß für unser Stück vom Kuchen, für die Blicke unter schräg geschnittenen Haaren, dem Hallo unter Nebelmaschinen.
Leisere Parole also, den Kofferraum voll mit Gelumpe der Vergangenheit und ein Leben nun im comme ci, comme ça. Die Alterskrankheit des mal-so-mal-so, diese Münze mit zwei Seiten, und heute weinst du, morgen lachst du, und alles und auch das andere läßt sich immer auch mal anders sehen. Mal bist du oben, mal bist du unten, Tralala, du buntes Karussell. Hinter jedem Ende wartet eine offene Tür. Und auf Regen folgt einfach noch mehr Regen.

Freitag, 25. März 2011
Und wie sie da so sitzt mit ihrem Miniverstärker auf dem Schoß wie ein vergessenes Fräulein mit abgeschabter Kunstlederhandtasche. Man möchte ihr sofort eine Blume schenken, eine neue Tasche oder ein selbstgeschmiertes Butterbrot.
Als ich heute morgen am Stutzflügel saß und ein paar Mollakkorde klimperte, dachte ich an all die anderen Sentimentalreisenden in den Wohnwagen und Eisenbahnwaggons, an den Schreibtischen und Datensammelstationen. Wie einzelne langsamer gehen, still stehenbleiben, gesichtslos, mundlos, augenlos. Wie hingetuscht mit flüchtiger Hand, dunkle Silhouetten auf den schwarzen und weißen Streifen eines Fußgängerüberwegs. Schmutzige Finger, die über eine Tonleiter huschen.