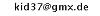Samstag, 20. März 2004
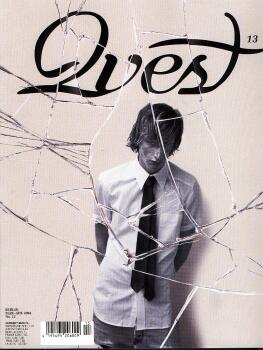 Ich neige ja zum oberflächlichen Schwadronieren. Nachschub für allerlei Nachtbetrachtungen liefert mir dabei die bunte Welt der Magazine. Ein gutes Magazin ist ein Fenster zur Welt und erspart so manche Reise. Oder weckt das Fernweh.
Ich neige ja zum oberflächlichen Schwadronieren. Nachschub für allerlei Nachtbetrachtungen liefert mir dabei die bunte Welt der Magazine. Ein gutes Magazin ist ein Fenster zur Welt und erspart so manche Reise. Oder weckt das Fernweh.
Seit Jugendjahren betrachte ich die gutsortierte Bahnhofsbuchhandlung als eine Art extendiertes Wohnzimmer. Am Wochenende blätter ich mich gerne quer durch die Welt. Und es gibt immer was zu entdecken. Neulich war es das "Cheerleader"-Special-Interest-Magazin. Gefüllt mit Hinweisen auf Wettbewerbe und den neuesten Choreographien aus Übersee. Heute fand ich ein ganz großes Magazin, in dem japanische Mädchen in den Kostümen ihrer Lieblingsmangas durchfotografiert waren. Kommt auf die Begehrliste, der Preis ist allerdings exorbitant für 48 oder so Seiten.
Das neue "Quest" hingegen wartet mit einer angenehm düsteren Ausgabe auf. Die Nr. 13 macht sich sozusagen selbst zum numerologischen Thema. Gewohnt schöne Fotostrecken, Gothic-Culture, ein Interview mit Gottfried Helnwein ("Kunst ist für mich eine Waffe, mit der ich zurückschlagen kann."), Arnold Schönberg (12Töner! 13! Got it?), ein alter Vergnügungspark in der Ex-DDR. Daniel Josefsohn, in den 90ern der Shooting-Star in der deutschen Fotoszene und mit seiner MTV-Strecke berühmt geworden, darf auch wieder mal... und dazu das übliche Gutschi, Putschi und Mutschi. Ein paar Texte nerven. Nullsätze wie "In Deutschland flüchten immer mehr Menschen in paranormale Glaubenswelten, um der kalten Realität zu entkommen", darf man höchstens in blogs schreiben. Aussagen wie "Der Glaube an die real existierende Allmacht des Teufels und die Macht des Bösen fand im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung ihr jähes Ende. Die dadurch entstandene Leere wurde von der damaligen Kunstwelt (Hieronymus Bosch u.v.a.) mit Genuss gefüllt", ist schon aus mehreren Gründen falsch. Bosch lebte von ca. 1450 - 1516 und hat weder was mit der Aufklärung noch mit dem 18. Jahrhundert zu tun.
Das Teil ist aber trotzdem ein Vergnügen auf dem coffee table. Zum Cappuccino.

Herr Kid, fragt man mich. Sie haben doch dieses Hermetische Caféhaus, in dem sie nebst Absonderlichkeiten aller Art doch bestimmt auch einen hervorragenden Cappuccino ausschenken. Wie machen sie eigentlich den Schaum? Sie besitzen doch bestimmt auch so einen elektrischen Miniquirl?
Mais non, au contraire, Mademoiselle. Die Zeit als ich noch batteriebetriebene Hilfsmittel einsetzen mußte, um die Dinge zum Schäumen zu bringen, sind doch schon länger vorbei. Sicher, diese Gerätschaften machen Spaß und erfüllen vor allem ihren Zweck. Aber am Ende eines langen Tages zählt doch nichts mehr als ehrliche Handarbeit.
 Seit einem halben Jahr benutze ich nur noch diesen klassischen Rührfix. Unsere Mütter und wahrscheinlich schon Großmütter haben damit einst Wunderdinge in ihren Küchen anrichten können. Ja, und es gibt sie noch, die Guten Dinge. Mein Rührfix allerdings ist ein Original, kommt vom Flohmarkt und hat mich einen Euro gekostet. (Achtung: Bei den neuen ist der Deckel des Rührwerks leider nicht mehr aus Bakelit.)
Seit einem halben Jahr benutze ich nur noch diesen klassischen Rührfix. Unsere Mütter und wahrscheinlich schon Großmütter haben damit einst Wunderdinge in ihren Küchen anrichten können. Ja, und es gibt sie noch, die Guten Dinge. Mein Rührfix allerdings ist ein Original, kommt vom Flohmarkt und hat mich einen Euro gekostet. (Achtung: Bei den neuen ist der Deckel des Rührwerks leider nicht mehr aus Bakelit.)
Es gibt auch eine Luxusversion mit einem gläsernen Messbecher. Wer diese besitzt, ist der König der Schaumschläger!
Nun die quick'n'dirty-Methode: Wer Barfrauen kennt, erfährt auch die kleinen Tricks der Gastroszene.
Wer also die Milch nicht erhitzen will (weil es z.B. schnell gehen muss), kippt einen Schluck heißen Wassers zur Verdünnung in die Milch. (Denn am besten eignet sich - man mag das ja nicht wahrhaben - verdünnte H-Milch. Auch das wissen Barfrauen.)
Zehn Sekunden kräftig und gleichmäßig rühren, fertig. Schon hat man prima Schaum. Kakaobestreuselung, ein Glas Wasser und den Keks nicht vergessen.

Es ist die Nacht des 9. November 1989. Das Fernsehen der DDR überträgt eine Pressekonferenz. Günter Schabowski, Mitglied des SED-Politbüros, verliest stockend eine Mitteilung des DDR-Ministerrates. Es herrscht Verblüffung, dann Tumult. "Wann?" fragt ein Journalist.
"Nach meiner Kenntnis sofort, unverzüglich."
Eine junge Frau tötet einen Mann. Sucht die Ader in seinem Hals und schneidet ihm mit einem Messer die Kehle durch.
Den sterbenden Mann läßt sie zurück in ihrer Wohnung zurück und stürzt hinaus in das Dunkel einer Stadt, die am Morgen eine ganz andere sein wird.
Zwei Ereignisse, seltsam unverbunden zunächst, bedingen einander, werden eins. In der Nacht, als die Mauer fällt, streift die junge Mörderin durch Berlin. Verfolgt von einem ostdeutschen Schäferhund. Einem der berüchtigten, scharfgemachten Tiere, die den Todesstreifen bewachen.
Thomas Hettche ist einer der wenigen westdeutschen Autoren, die sich literarisch mit dem Fall der Mauer und dem Thema "1989" auseinandergesetzt haben. Sein Roman Nox (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995) nähert sich in einer merkwürdig kalten, dokumentarischen Sprache einem hochemotionalen Thema. Seine Figuren jagt er durch eine in mehrerer Hinsicht historischen deutschen Nacht, in der die Zeit aber stillzustehen scheint.
Das Personal ist bizarr. Ein Geräuschemacher, ein Pathologe, die Mörderin, eine pseudohedonistische Gruppe, die sich die Zeit mit Kokain, anonymen Sex und sadomasochistischen Ritualen vertreibt. Die Orte "erlesen": Die berühmte medizinhistorische Sammlung Virchow mit ihren "Monstren", ein Schiff, das auf dem Landwehrkanal Richtung Mauer fährt, Parties, Hinterzimmer von Kneipen, sterile Wohnungen.
Ähnlich gequält aber wirkt auf Dauer die betont sachliche Sprache, die konstruierten Bilder. Da ist viel von Schnitten die Rede. Die Mauer als Schnitt, die Öffnung als solcher. Ein zerschnittenes Land teilt sich die sprachlichen Bilder mit dem Messer, das die Kehle durchtrennt, mit den Sektionssälen der Charité, mit einem Mann, dessen Haut durch S/M-Praktiken zerschnitten und mit Zeichen übersäht ist.
Die symbolischen Handlungen folgen teilweise so platt aufeinander, daß der literarische Taschenspielertrick nicht mehr zu übersehen ist. Einmal folgt auf die Beschreibung einer schmerzhaften Penetration ("Die kühle Betäubung des Pulvers nahm den Schmerz nicht, als er in sie eindrang, sondern verstärkte ihn noch...") nur wenige Seiten später schon die symbolische Paralelle. Die Grenze öffnet sich, die DDR-Bürger strömen in die Stadt, "drängen" in den Westen: "Der Schmerz brannte im Körper der Stadt, und ihre Augen zuckten hinter den geschlossenen Lidern im Schlaf, während das Schiff langsam immer weiter in sie hineinglitt."
Derlei Konstrukt aus dem Writer's Workshop zerstört leider immer wieder den Eindruck, man hätte es hier mit tiefschürfender, ernsthafter Literatur zu tun. Angereichert mit ach-so-gewagten Sexpraktiken und den ebenso bemüht wirkenden Schauerbeschreibungen aus Virchows Pathologischer Präparatesammlung, heischt der Roman mit Oberflächenreizen um Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig ist er geradezu krampfhaft bemüht, mit seiner gewählt schmucklosen Sprache den Eindruck eines feingewobenen Kunstwerks zu suggerieren.
Das Schauersujet als Kaltnadelradierung. Aber Hettche ist nicht Goya. Er bleibt artifiziell, kunstgewerblich. Merkwürdig, erst gegen Ende des Romans lebt der Autor auf. Dann nämlich, als er vom Leiden der Wachhunde am Grenzstreifen berichtet. Dann, als er vom poetischen Träumen, der Sehnsucht dieser gequälten Tiere schreibt. Der Autor liebt die Menschen nicht. Der Autor ist ein Tierfreund.
Dennoch, das Buch ist lesenswert. Zumal man im Grunde immer noch nicht begriffen hat, was 1989 eigentlich passiert ist. Weil man manchmal noch stockt, wie weiland Schabowski. Vielleicht ist es auch bezeichnend, daß ein westdeutscher Autor einen solch düsteren Ton anschlägt, während Thomas Brussig, Reinhard Ulbrich und Co. das Thema so humorvoll angehen.
Ach, und Suhrkamp: Man schreibt nicht "Pobaken".