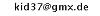Donnerstag, 13. März 2008
Heute morgen hieß es nüchtern bleiben, was mir am Frühstückbüffet, das mir meine philippinische Hausdienerschaft aufgefahren hatte schon schwer fiel, vom Magen her, aber noch später dann vom Herzen. Meine Ärztin nämlich, mütterlicher Typ, ging letztes Jahr mit einem überraschendem Tschüß in Pension. Heute nun konsultierte ich ihre Nachfolgerin, aber erstmal ging es ins Labor, man interessiert sich bekanntlich für Körperflüssigkeiten in diesem Metier. Und siehe, Erscheinung, auch dort herrscht spendet neues Personal Liebreiz. Blutlüstern nähert sich mir nämlich eine frische, allerdings viel zu junge Dame [Symbolfoto] im rasant geschnittenen Schwarzhaarpony, Typ Emo-Punk in Trainingsjacke. Mein Blut pocht ihr geradezu entgegen, während ich mit flirrendem Blick (kann am Blutdruck gelegen haben, Systole, Diastole, nein, nein, mir geht es gut, vielleicht besser hinlegen?) die Bewegungen ihrer zarten Hand beobachte. Und ihre Augen.
Dann, wie abgeschoben, ein letztes Lachen auf eine meiner launigen Bemerkungen ("Läuft." Stromberg) schwebt mir hinterher, sitze ich im Wartezimmer, döse ein wenig, wie weggetreten vom Blutverlust Schlafmangel der letzten Zeit, da steht meine Ärztin vor mir. Jung, aber nicht zu sehr, ganz in Schwarz, die Haare, die Kleidung, denn Kittel gibt es hier nicht, die Lippen blutrot, ein freundliches Lächeln, so bittet sie mich hinein. Ich komme jetzt immer zu Ihnen, sage ich, noch ehe wir angefangen haben. Sie lächelt, wir diskutieren meine Werte, alles ganz gut, ich bin im Grunde topfit, nicht älter als, sagen wir mal, 37, also wenn man jetzt nur mein Blut sähe. Den Rest schiebe ich auf den Kummer, das versteht sie gut. Ob ich nicht einen Kardiologen aufsuchen möchte. Nö, meine ich, ich weiß ja, daß ich es derzeit am Herzen habe. Und schon lachen wir gemeinsam, sowas finden Mediziner witzig. Sie sieht gut aus, wenn sie lacht, sonst aber auch. Ich muß an mein Faible für medizinisch geschultes Personal denken, während sie meinen Körper betastet, hier mal und da auch.
Sie komme aus Berlin, entlocke ich ihr später, während ich mich langsam wieder anziehe und dabei diesen Trick mit meiner Oberarmmuskulatur mache. Eine Medizinerin aus Berlin hauche sage ich. Warten Sie, ich habe irgendwo noch einen Verlobungsring. Tolle Stadt, befinde ich und meine sie. Vorsichtshalber verkneife ich es mir, sie zu fragen, ob sie mir nicht mal was zeigen will. Von Berlin. Sie strahlt mich noch mal an aus großen Augen.
Wir sehen uns in drei Monaten, meint sie. Ich schaue sie an und weiß, sie hält ihre Termine ein.

Mittwoch, 12. März 2008
(Twin Peaks)

Sitzen, seine Träume ordnen, die Erinnerungen. Vorausblicken durch grünes Glas, Zurückblicken ins rote Licht, wie ein Aquarium mit dem schönen Fisch, der still seine Kreise zieht. Wie alles war, wie alles kam, wie alles sich änderte. Mehr Mulder & Scully als Lulu & Sailor, aber dann eben auch und länger dafür und dauerhafter und ohne den großen Krawall, außer dem, den ich selber machte.
Die gemeinsame Geschichte, die Tage, die zusammenwuchsen, das Lachen, die Gespräche, das Zaudern an den wesentlichen Punkten, der unerschütterliche Kern, der mit der Zeit ein wenig kleiner wurde. Rundgelutscht wie ein Eiswürfel im Mund, wie sich überhaupt erst Kühle, dann Kälte, dann Eis um dieses sonderbare Band legte, bis es eines Tages zerbrach. Wie man dann, unsicher erst oder trotzig, für sich selber gehen lernt, halb lahm, das linke Auge blind. Bis man stehenbleiben kann und zurückschaut und sieht, was gut war.
Wie ich mir nie Gedanken machen mußte, so wie später, ob mein Name nun ein "exotischer" war oder eher nicht. Ob ich eine Erinnerung war, die man vertreiben muß. Aus dem Kopf und aus dem Herzen. Oder ob du eigentlich jemand anderen meinst. Weil alles war, wie es war, ohne wenn und ohne aber und wir nicht zweifelten. Wie wir nicht immer gemeinsam feierten, aber trotzdem alles von einander wußten, spürten, immer, durch dieses sonderbare Band. Das Datum natürlich und wichtiger noch, was wir hatten, was uns fehlte. Wie wir uns oft fehlten.
Schwimm, kleiner Fisch. Es wird alles ganz wunderbar.

Dienstag, 11. März 2008
Beim ersten Mal dachte ich, hm. Beim zweiten Mal, hm ja. Nun, nach dem dritten Mal bin ich begeistert: Fell (OT: Fur) beschreibt eine Epsiode aus dem Leben der Fotografin Diane Arbus, die am 14. März 85 Jahre alt geworden wäre.
Steven Shainberg, Regisseur des ganz entzückenden Films Secretary, erzählt nicht die Biografie der Arbus, sondern in wunderbar fotografierten Tableaus den entscheidenden (fiktiven) Wendepunkt ihres Lebens. Wie sie die luxuriöse, oberflächliche und hohl glitzernde Welt ihrer pelztragenden High-Society-Eltern verläßt und eine ganz andere findet: Die der "Anderen", der Freaks und Transvestiten, der Artisten und Ausgestoßenen. Manchmal muß man Gehen, um Anzukommen.
Arbus (Nicole Kidman) folgt wie Alice im Wunderland dem weißen Kaninchen und entdeckt Stück für Stück eine neue, bizarre Welt, enträtselt die Geheimnisse des Kellers und das Mysterium des Dachgeschosses. In surreal angehauchten Szenen entwickelt sich die Freundschaft zu Lionel Sweeney (Robert Downey Jr.), einem Mann, der an Hypertrichose, dem sogenannten "Werwolf-Syndrom" leidet. Sein exzessiver Haarwuchs, sein "Fell" ist die Kehrseite der schönen Raubtierpelze, die Arbus' Ehemann in Szene setzt. Je weiter sich Diane in diese traumhafte Welt verliert, desto klarer scheint ihr die neugefundene Realität. Desto wacher wird sie.
Technisch nicht übertrieben versiert, ging Diane Arbus bis zu ihrem frühen Freitod 1971 einen nicht immer unbeirrten, aber traumwandlerisch-wagemutigen Weg dahin, wo Amerika nicht ganz so schön ist. Sie suchte die Ästhetik des Häßlichen, das Abstoßende, das Aufregende - und ihre eigenen Ängste. Die Reaktionen auf ihre Fotos waren ablehnend bis haßerfüllt - sehr zu Arbus' Überraschung, die sich, so vermute ich, nicht immer was dabei dachte. Heute gilt sie als eine der bemerkenswertesten US-Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. Ich bin natürlich Fan.
Shainberg spielt geschickt mit Fetischen wie Haar, Masken, Nackheit und Musik, verschönt, wo es der Arbus ums Radikale und Häßliche ging, weidet die sexuellen Aspekte aber nicht aus. Am Ende, am Ende des Films jedenfalls, geht es sowieso um eine ganz andere Liebe. Um einen anderen Atem. Am Ende geht es um Inspiration. Am Ende geht es um das Erwachen.
(Fell. Fur. USA 2006. Regie: Steven Shainberg.)
>>> Trailer
- Kritik zur Arbus-Biografie von Patricia Bosworth (Deutschlandradio)
- Bildersuche

Montag, 10. März 2008
Die Haut, sagen Dermatologen, sei wie ein Erinnerungsrekorder des Lebens. Sie verliere schnell ihre Unschuld, vergesse nichts und komme mit der Zeit daher wie ein Mole-Skin (pun intended): verbrannnt, beschriftet, gezeichnet, geknickt und verknittert, voller Flecken, Risse und Dellen.
Die Haut ist zart, fest und verletzlich, eine Seele von einem Organ. Oft schön anzuschauen, noch öfter aufregend anzufassen (die fremde Haut) ist sie manchmal ein Versprechen, von dem, was sein wird, immer aber ein Echo, von dem, was war. Die Schnitte bleiben. Narben sind in dieser Hinsicht etwa so wie Knutschflecken des Lebens. Leider können sie oft nicht Freunde sein, obwohl sie einen Vorteil haben: Sie verlassen einen nicht.
>>> Fotosammlung von (Operations-)Narben

Freitag, 7. März 2008

Stumm steige ich aus dem Zug, fahre zurück durch die Stadt und gehe die bergige Straße zum Friedhof hinauf. Ich bin früh, meine Mutter ist bereits da und eine Nachbarin, eine vergessene Bekannte. Wir grüßen uns freundlich, tauschen belanglose Worte, bergen uns in unsere Mäntel. Rechtzeitig zur Beerdigung hat sich das Wetter in das für diese Stadt so typische kalte und nieselige Grau verwandelt, immer wieder höre ich Sätze, die betonen, wie schön es gestern gewesen sei. Mein Cousin tritt auf einmal aus der Trauerkapelle, tritt neben uns, steht neben sich, dankt, grüßt, dankt und fragt, wer hineinkommen möchte, der Sarg sei noch offen. Ich folge ihm als einziger, stumm, schleiche vorbei an den Bestattern, die diesen letzten Wunsch erfüllen. Vor dem Kreuz steht auf einem Gestell der Sarg, meine Tante darin.
Ich habe sie lange nicht gesehen, aber nun betrachte ich ihr wächsernes Gesicht, die weißen, fein zurückgekämmten Haare. Gut sieht sie aus, friedlich, aber nicht schlafend. Mein Cousin streicht ihr über die Wange, ich sage etwas, halte einen Schritt Abstand, respektvoll, aber auch etwas scheu. Wir wechseln ein paar Worte, etwas Privates, er erzählt mir, was er nun sieht. Wir lösen uns schließlich aus stummen Minuten, ich sage, vielleicht sei es Zeit, nun zu gehen. Die Bestatter nicken, sie werden den Sarg nun schließen, irgendwo gibt es immer soviel zu tun.
Die Zeremonie beginnt, ich lotse meine Mutter nach vorne, wir nehmen Platz in unserer Reihe, ich sitze hinter meinem Cousin, dem die erste Reihe gebührt. Er sitzt dort allein, der Rest seiner Familie, und mir wird bewußt, plötzlich, daß es eines Tages ich sein werde. Die Trauerkapelle ist kalt, vielleicht kommt daher das Zittern.
Die Orgel spielt eine Strophe, es geht schnell, der Trauerredner ergreift das Wort. Alles habe seine Zeit im Leben des Menschen, fängt er an, ich denke an den Zufall mit Isa und frage mich, ob wir wohl Korn trinken werden, später am Grab. Die Biografie der Toten, ein karges Gerüst, in der Mitte das Schiff, das der Gustloff folgte.
Die Trauerrede ist nüchtern, ich merke, wie ich abschweife, mich an anderes erinnere, und dann wie gebannt auf eine Kranzbinde starre, auf der ich einen Schreibfehler entdecke. Je länger ich schaue, um so deutlicher, fast schmerzhaft laut tritt er hervor. Und das ist es schließlich, was mich berührt: das wir immer einfache Leute waren. Immer so viel Scheitern, immer diese rührende Unbeholfenheit, immer aber dieses unbeirrte Bemühen, das ich so häufig bei anderen nicht fand.
Wir gehen hinaus, still, folgen den Trägern, die den Sarg auf einem Rollwagen den Berg hinaufwuchten, drängen und schieben, gleich ihren Atemwolken vor sich her, ganz bis nach oben, wo die Grabstelle liegt. Ringsum schwere Erde, an dicken Seilen senkt sich der Sarg, die Träger nehmen die Mützen ab, halten inne, streifen die weißen Handschuhe ab, werfen sie hinterher, ein letzter Gruß. Der Trauerredner spricht ein letztes Gedicht, wirft Erde, dann treten der Reihe nach die Verwandten vor. Meine Mutter hält meinen Cousin, dann sieht sie selbst ganz klein aus auf einmal, und ich stehe neben ihr, halte sie fest, während sie ihren kleinen Strauß wirft, die Schwester zur Schwester. Ich selbst bleibe stumm, achte auf meine Mutter, führe sie zur Seite, nehme weder Erde noch Blumen, lasse die anderen vor. Erst ganz am Ende, die Menschen gehen den Berg wieder hinunter, gleiten durch das nieselige Grau, ein Zug schwarzer Mäntel, drehe ich noch einmal um, kehre zurück, ganz allein, nur ich und die Stille, sage Tschüß und werfe eine Blume ins Grab.

Mittwoch, 5. März 2008
Die Bilder des New Yorker Fotografen Noah Kalina sind jung, voll starker Kontraste und von einer angenehm kühlen Sachlichkeit. Gefrorenes Leben, weitgehend emotionslos, Geschichten, die meist genau vom Punkt zwischen dem Danach und einem Davor erzählen. Ein stummes Warten, kein Geschrei.
Von ihm stammt auch das berühmte Video, das einen Zusammenschnitt seines Projekts zeigt, für das er seit 2000 jeden Tag ein Foto von sich macht. Sich selbst festhält.
>>> Webseite von Noah Kalina

Dienstag, 4. März 2008
Mittlerweile zu müde für irgendwas. So als wäre mein Kopf unter Wasser gedrückt, zu lange vielleicht, so als läge mir trübes Blei in den Augen. Zu müde zum Atmen, zum Weinen und lange schon zu müde zum Hoffen. Wann alles anfing, wann alles endete. Die Finger tasten nach den glitschigen Wurzeln, suchen Halt und festeren Grund. Schwimmen, Kriechen, Straucheln, es geht ja immer weiter, raus aus der Kälte, du holst dir was weg, Kind, sei doch vernünftig. Durch einen Sumpf nun aus verletzter Eitelkeit, entfesselten Gewisper und dem inszenierten Ich. In die Rinde eines Baums hat jemand ein Herz geschnitten. Das aber, immer nur das, ist das einzige, was zählt.
Das Pflaster, lehrt uns die Vernunft, muß ab, bevor es eitert. Sonst bleibt am Ende nur die Axt. Wir werden noch den Abspann schauen, nicht mehr die entfallenen Szenen. Später vielleicht, so denkt man, irgendwann, soll das angeblich lustig sein, die verpatzten Einsätze und vergessenen Dialoge. Sage aber keiner, selbst die Strümpfe wären bis dahin zu wenig heiter.
via The Anatomy of Anxiety