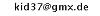Sonntag, 7. August 2005
Reine Autobiographien werden geschrieben: entweder von Nervenkranken,
die immer an ihr Ich gebannt sind, wohin Rousseau mitgehört;
oder von einer derben künstlerischen oder abenteuerlichen Eigenliebe,
wie die des Benvenuto Cellini; oder von gebornen Geschichtsschreibern,
die sich selbst nur Stoff historischer Kunst sind;
oder von Frauen, die auch mit der Nachwelt kokettieren;
oder von sorglichen Gemütern, die vor ihrem Tode
noch das kleinste Stäubchen in Ordnung bringen
möchten, und sich selbst nicht ohne Erläuterungen
aus der Welt gehen lassen können. (Schlegel, 1798.)
Was schreiben wir? Selbstentäußerung. Was suchen wir? Vergebung. Wen finden wir? Komplizen. Der Leser, nie besser oder schlechter als wir, sammelt die Fragmente: "Es steht bei ihm, diese Teile zu sammeln und das Wesen zu bestimmen, das aus ihnen besteht; das Ergebnis soll ein Werk sein; und wenn er sich irrt, so ist der Fehler seine Sache". (Foucault, Schriften zur Literatur, 1988.)
Gestaltete Wirklichkeit, Erdachtes, Erlogenes, heimlich Wahres. Wird Robert Smith eigentlich jeden Abend daheim gefragt: "Was hast du denn Schlimmes erlebt, sag. Du hast heut auf der Bühne so traurig geklungen"? Ich denke, nicht. Ich hoffe es, denn sonst wird Herr Smith wohl mit den Augen rollen und sagen, Schatz (oder was immer er zu Hause so sagt), Schatz, mach dir keine Gedanken, es war nur ein Lied.
Ein Lied, das von irgendwoher kam und keine Quelle mehr kennt und keine Wirklichkeit, sobald es gesungen ist. Nur die Wirklichkeit, den Ort des Vortrags und die Quelle, die Deutung, die andere ihm beimessen.
"In gewisser Weise handelt es sich um eine écriture, in der dem Autor die Aufgabe zufällt, einen vollständigen und wahrhaftigen Bericht seiner seelischen Zustände zu geben, und dem Leser, aus diesem Material das soi zu bestimmen. Diese Figur einer gleichsam arbeitsteilig hergestellten écriture de soi erinnert an die Geschichten, aus denen [...] Mediziner und Psychiater beginnen "Fälle" zu rekonstruieren. Der Patient gesteht, der Arzt diagnostiziert.
(Sabine Maasen, Genealogie der Unmoral, 1998.)
Man schreibt, erzählt, wählt aus, schleift, läßt aus und setzt hinzu. Kurz, man gestaltet. Der eine bewußter, der andere weniger so. Man spinnt fort, strickt einen Faden, läßt ihn fallen, nimmt ihn auf, zerrt ihn hinter sich her durch ein Labyrinth, dessen Ende oder Ausgang niemand kennt. Reden, schreiben, singen: Alles sagen oder alles Sagen?
Und wer dann doch den Ausgang findet? Gejagt vielleicht vom Minotaurus oder gelenkt von der eigenen Rettungsleine, dem Rückholfädchen der furchtlosen Helden? Sie können Ihren Computer jetzt ausschalten.
Dieser Ausgang ist nur der Eingang zu einem anderen Labyrinth.