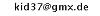Freitag, 7. März 2008

Stumm steige ich aus dem Zug, fahre zurück durch die Stadt und gehe die bergige Straße zum Friedhof hinauf. Ich bin früh, meine Mutter ist bereits da und eine Nachbarin, eine vergessene Bekannte. Wir grüßen uns freundlich, tauschen belanglose Worte, bergen uns in unsere Mäntel. Rechtzeitig zur Beerdigung hat sich das Wetter in das für diese Stadt so typische kalte und nieselige Grau verwandelt, immer wieder höre ich Sätze, die betonen, wie schön es gestern gewesen sei. Mein Cousin tritt auf einmal aus der Trauerkapelle, tritt neben uns, steht neben sich, dankt, grüßt, dankt und fragt, wer hineinkommen möchte, der Sarg sei noch offen. Ich folge ihm als einziger, stumm, schleiche vorbei an den Bestattern, die diesen letzten Wunsch erfüllen. Vor dem Kreuz steht auf einem Gestell der Sarg, meine Tante darin.
Ich habe sie lange nicht gesehen, aber nun betrachte ich ihr wächsernes Gesicht, die weißen, fein zurückgekämmten Haare. Gut sieht sie aus, friedlich, aber nicht schlafend. Mein Cousin streicht ihr über die Wange, ich sage etwas, halte einen Schritt Abstand, respektvoll, aber auch etwas scheu. Wir wechseln ein paar Worte, etwas Privates, er erzählt mir, was er nun sieht. Wir lösen uns schließlich aus stummen Minuten, ich sage, vielleicht sei es Zeit, nun zu gehen. Die Bestatter nicken, sie werden den Sarg nun schließen, irgendwo gibt es immer soviel zu tun.
Die Zeremonie beginnt, ich lotse meine Mutter nach vorne, wir nehmen Platz in unserer Reihe, ich sitze hinter meinem Cousin, dem die erste Reihe gebührt. Er sitzt dort allein, der Rest seiner Familie, und mir wird bewußt, plötzlich, daß es eines Tages ich sein werde. Die Trauerkapelle ist kalt, vielleicht kommt daher das Zittern.
Die Orgel spielt eine Strophe, es geht schnell, der Trauerredner ergreift das Wort. Alles habe seine Zeit im Leben des Menschen, fängt er an, ich denke an den Zufall mit Isa und frage mich, ob wir wohl Korn trinken werden, später am Grab. Die Biografie der Toten, ein karges Gerüst, in der Mitte das Schiff, das der Gustloff folgte.
Die Trauerrede ist nüchtern, ich merke, wie ich abschweife, mich an anderes erinnere, und dann wie gebannt auf eine Kranzbinde starre, auf der ich einen Schreibfehler entdecke. Je länger ich schaue, um so deutlicher, fast schmerzhaft laut tritt er hervor. Und das ist es schließlich, was mich berührt: das wir immer einfache Leute waren. Immer so viel Scheitern, immer diese rührende Unbeholfenheit, immer aber dieses unbeirrte Bemühen, das ich so häufig bei anderen nicht fand.
Wir gehen hinaus, still, folgen den Trägern, die den Sarg auf einem Rollwagen den Berg hinaufwuchten, drängen und schieben, gleich ihren Atemwolken vor sich her, ganz bis nach oben, wo die Grabstelle liegt. Ringsum schwere Erde, an dicken Seilen senkt sich der Sarg, die Träger nehmen die Mützen ab, halten inne, streifen die weißen Handschuhe ab, werfen sie hinterher, ein letzter Gruß. Der Trauerredner spricht ein letztes Gedicht, wirft Erde, dann treten der Reihe nach die Verwandten vor. Meine Mutter hält meinen Cousin, dann sieht sie selbst ganz klein aus auf einmal, und ich stehe neben ihr, halte sie fest, während sie ihren kleinen Strauß wirft, die Schwester zur Schwester. Ich selbst bleibe stumm, achte auf meine Mutter, führe sie zur Seite, nehme weder Erde noch Blumen, lasse die anderen vor. Erst ganz am Ende, die Menschen gehen den Berg wieder hinunter, gleiten durch das nieselige Grau, ein Zug schwarzer Mäntel, drehe ich noch einmal um, kehre zurück, ganz allein, nur ich und die Stille, sage Tschüß und werfe eine Blume ins Grab.